Die erste technische Einrichtung zur Erzeugung von brennbaren Gasen aus Holz und anderen Materialien (Steinkohle) wurde von seinem Erfinder, dem Franzosen Philippe Lebon als »thermolampe« bezeichnet, was in deutsch als Thermolampe übernommen wurde.
Als Pionier der Gasbeleuchtung gilt der schottische Erfinder William Murdoch der in Cornwall für Boulton& Watt arbeitete. Sein Haus in Redruth war 1791 das erste Gebäude mit Gaslicht aus der Verkokung von Steinkohle.
Lebon experimentiert mit Holz und erhält darauf am 29. September 1799 ein Patent. Lebon publiziert eine vielbeachtete Schrift, in der er visionär die wichtigsten Einsatzmöglichkeiten von Gas vorhersagt: die Beleuchtung, die Heizung, das Kochen, aber sogar auch schon den Verbrennungsmotor (dieser wird erst 60 Jahre später erstmals von Lenoir erfunden!). Er organsierte 1801 eine öffentliche Vorführung in Paris und einer der Besucher ist Gregory Watt, der Sohn von James Watt. Dieser drängt Murdoch zur Intensivierung der Arbeiten an der Gasbeleuchtung um Lebon zuvorzukommen.
Auch ein anderer Besucher erkennt das wirtschaftliche Potenzial. Ein deutscher Kaufmann, der die englische Staatsbürgerschaft angenommen hatte und sich Frederick Albert Winsor (ursprünglich Winzer) nannte, widmet sich für den Rest seines Lebens ganz der Entwicklung der Gastechnik. Er will Lebons Patent in England verwerten, übersetzt die Schrift über die Thermolampe, versucht ihm ein Exemplar abzukaufen Lebon verweigert ihm jedoch – wie vielen andern auch – die Zusammenarbeit.
Winsor kehrt in seine Heimatstadt Braunschweig zurück und gibt eine dreisprachige Übersetzung von Lebon’s Schriften heraus und entwickelt selbst einen »Patentofen« Im Laufe der Jahre entwickelt er seinen Ofen in kleinen Schritten weiter und erhält – nachdem er nach England zurückgekehrt war – am 18. Mai 1804 dafür sogar ein Patent. Winsor’s Patent-Ofen kann unterschiedlichen Brennmitteln, wie Holz und Kohle nutzen, kann Gas, Öl, Teer und Säuren herstellen und hinterlässt als Abfallprodukt Koks bzw. Holzkohle .
August Wilhelm Lampadius, Professor in Freiberg/Sachsen hat seinem Kurfürstenen in dessen Schloß in Dresden bereits 1799 eine Thermolampe vorgeführt.
Es gibt ein Buch aus dem Jahr 1803 mit dem Titel »Die Thermolampe in Deutschland« von Zacharias Andreas Winzler, der eine solche Thermolampe in seinem Haus in Znaim (heute Znojmo 75 km nördlich von Wien) aufgestellt
Er bezieht sich ausdrücklich auf das Patent von Lebon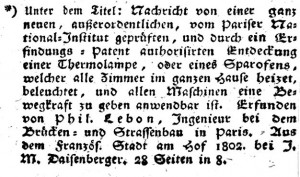 nennt die genaue Quelle der deutschen Veröffentlichung. Er schreibt von einer Vielzahl von Berichten in Zeitungen, die er nich alle kennen könne, aber nennt 3 Flugblätter und Bröschüre
nennt die genaue Quelle der deutschen Veröffentlichung. Er schreibt von einer Vielzahl von Berichten in Zeitungen, die er nich alle kennen könne, aber nennt 3 Flugblätter und Bröschüre
- vom Erfinder Lebon selbst
- von einem nicht bekannten Autor aus Pirna erstellte Beschreibung auf 19 Seiten von 1802
- Wenzlers Beschreibun mit 36 Seiten.
Beim zweiten handelt es vermutlich um das Buch von Carl Gottfried Bünger, Abbildung und Beschreibung einer Thermolampe: Nebst einem zweckmässigen Apparat zur Zimmerbeleuchtung(Pirna, 1802). Ein Hinweis unter Notizen in »Neues allgemeines Journal der Chemie«, Band 1, Seite 464. 3. Neue Einrichtung einer Thermolampe von C. Bünger, Besitzer der Löwen-Apotheke in Dresden. Er hielt Vorlesungen über Experimentalchemie. Er kannte den Apparat von Lampadius, hiel seine eigne Konstruktion aber für besser. Er betreibt ihn mit Scheitholz oder Kohle (durch Umstellen der Luftmenge) und betreibt das Laboratorium seiner Apotheke damit.
Zacharias Andreas Winzler hatte 1802 aus der Zeitung erfahren und baute einen Apparat, den er »Universal-Leucht-, Heiz-, Koch-, Sud-, Destillier- und Sparofen« nannte und vom Kreishauptmann Vincent Elden von Rosenberg in Znaim oder für die Kunstgalerie des Grafen Joseph Deym in Wien. Deym besaß eine der größten Wachsfigurensammlungen, in der sämtliche Persönlichkeiten jener Zeit als Figur vorhanden waren. Diese Wachsfiguren wurden in der Galerie auf einer exotischen oder heroischen Art dargestellt, während Musik von Wolfgang Amadeus Mozart, wiedergegeben durch Orgelwalzen und andere Musikautomaten, spielte.
Sein Buch ist »Die Thermolampe in Deutschland; Oder: vollständige, sowohl theoretisch- als praktische Anleitung, den ursprünglich in Frankreich erfundenen, nun aber auch in Deutschland entdekten Universal-Leucht-Heiz-Koch-Sud-Destillir- und Sparofen zu errichten« enhält vier Kupfertafeln mit Details. Es ist eine Liste von über 300 namentlich genannten Interessenten (Preänumeranten) , die sich aufgrund einer Meldung in der Presse bei ihm gemeldet hatte und sowie 22 Subskribenten enthalten.
Das Wiener Gasometer hat dazu die folgende Beschreibung veröffentlicht.

Im Ofen links wurde im unteren Bereich eingeheizt (c). Darüber befindet sich eine zweihalsige Querretorte (e) aus Gusseisen oder Ton, in der das zu entgasende Material (Steinkohle) gefüllt wird. Oberhalb befindet sich der Kochherd (f) und ein Bratrohr (g). Durch das Rauchrohr (h) zog der Rauch der Beheizung ab. Das Dampfrohr (i) leitete den Dampf aus dem Kochbereich ab. Das Gas aus der Retorte wurde über das Gasrohr (k) durch den Abkühler (l) geleitet um es abzukühlen und Reststoffe im Gas im Teerbehälter (m) absetzen zu lassen. Optional erfolgte auch eine Reinigung des Gases durch Kalkmilch.
Weitere Exemplate wurden in der Wohnung des damaligen Kreishauptmannes Vinzenz Edler von Rosenzweig und in der Kaserne aufgestellt. Auf Veranlassung des k.k. Feldzeugmeisters in Brünn, Graf Baillet de Latour, wurde diese Lampe in der Kaserne auf der Znaimer Burg zum Beheizen der Zimmer und zur Bereitung des Essens für 50 bis 60 Mann eingesetzt.
 Die Bezeichnung »Themolampe« wurde allgemein für das Verfahren benutzt, unabhängig vom Brennstoff (vgl. Lampadius, Wilhelm August, Ueber Strassenbeleuchtung mit Steinkohlen durch die Thermolampe vorzüglich in Hinsicht ihrer Anwendung im Großen in Schweigger’s Journal, 8. – Nürnberg, in der Schrag’schen Buchhandlung, 1813,)
Die Bezeichnung »Themolampe« wurde allgemein für das Verfahren benutzt, unabhängig vom Brennstoff (vgl. Lampadius, Wilhelm August, Ueber Strassenbeleuchtung mit Steinkohlen durch die Thermolampe vorzüglich in Hinsicht ihrer Anwendung im Großen in Schweigger’s Journal, 8. – Nürnberg, in der Schrag’schen Buchhandlung, 1813,)
Für die Popularität des Begriffs spricht, daß 1815 ein Theaterstück it dem Titel »Der schwatzhafte Kuß, oder die Thermo-Lampe. Eine Kleinigkeit in Versen und einem Akte« von Joachim Perinet aufgeführt wurde.
Scan bei der österreichischen Nationalbibliothek, Signatur: 621744-A.Adl.3
Literatur
in Leslie Tomory, Gaslight, distillation, and the Industrial Revolution, Hist. Sci. , xlix (2011)
-
1. Dean Chandler and A. Douglas Lacey, The rise of the gas industry in Britain(London, 1949); Johannes Körting,Geschichte der deutschen Gasindustrie mit Vorgeschichte und bestimmendenEinüssen des Auslandes (Essen, 1963); Arthur Elton, “Gas for light and heat”, in A history of technology , iv:The Industrial Revolution c. 1750 to c. 1850, ed. by Charles Singeret al. (Oxford,1958), 258–75; Stirling Everard, The history of the Gas Light and Coke Company, 1812–1949 (London, 1949); John Charles Grifths, The third man: The life and times of William Murdoch,1754–1839, the inventor of gas lighting (London, 1992); François Veillerette, Philippe Lebon,ou, L’homme aux mains de lumière: La vie et l’oeuvre de l’illustre inventeur français du gazd’éclairage et du chauffage au gaz (Colombey-les-Deux-Eglises, 1987).
9. In addition to ref. 75 below, see “Art. IX. Gemeinnüzige Anzeigen”, Gnädigst-privilegirtes Leipziger Intelligenz-Blatt auf das Jahr 1803, xxxvii (1803), 304–5; “Versuch mit der Thermo-Lampe”, Magazin der Handels- und Gewerbskunde, i (1803), 514–15; “Neue Einrichtung der Thermolampe:Von C. Bünger, Apotheker in Dresden”, Neues allgemeines Journal der Chemiei (1803), 464–6;“Notizen: Thermolampe und Consorten”, Allgemeines Journal der Chemie, x (1803), 644–65;“Winzlers Thermolampe”, National-Zeitung der Teutschen(1803), 855–6; Karl Bünger, “NeueEinrichtung der Thermolampe zum pharmaceutischen Gebrauche”, Annalen der Physik,xv(1803), 231–4; Friedrich Kretschmar, “Vervollkommung der sogenannten Thermolampe zumGebrauche für das Haus-, Fabrik- und Hüttenwesen”, Annalen der Physik,xiii (1803), 498–502;“Winzlers Thermolampe”, Physikalisch-ökonomische Bibliothek , xxii (1804), 343–54; CarlGottfried Bünger, “Neue Einrichtung der Thermolampe zum pharmaceutischen Gebrauchvom Herrn Apotheker Bünger in Dresden”, Journal der Pharmacie für Aerzte, Apotheker, und Chemisten, xii (1804), 101–4; Franz Sax,Vollständige Anleitung zur Holzsparkunst: Besonders für die österreichischen Staaten; nebst einer Beschreibung der Lebonischen Thermolampe; zur Verbreitung gemeinnütziger Kenntnisse (Vienna, 1804); “Thermolampe”, in Handwörterbuchder Naturlehre: Insonderheit für Ungelehrte und für Liebhaber dieser Wissenschaft , ed. by KarlPhilip Funke (Leipzig, 1805), 287–93.10. “Thermolampe”, in Oekonomisch-technologische Encyklopädie, oder allgemeines System der Staats- Stadt- Haus- und Landwirthschaft und der Kunstgeschichte, clxxxiii, ed. by WilhelmDavid Korth (Berlin, 1844), 254–60, pp. 256,
-
10. “Thermolampe”, in Oekonomisch-technologische Encyklopädie, oder allgemeines System der Staats- Stadt- Haus- und Landwirthschaft und der Kunstgeschichte , clxxxiii, ed. by WilhelmDavid Korth (Berlin, 1844), 254–60, pp. 256, 258
-
11. William Henry, “Experiments on the gases obtained by the destructive distillation of pit coal, &c.,with a view to the theory of their combustion when employed as sources of articial light”, A journal of natural philosophy, chemistry and the arts, xi (1805), 65–74, p. 69. See also Körting, op. cit. (ref. 1), 129–30.
- 58. J-P. Pointe, “Jean-Baptiste Lanoix”, Revue du Lyonnais, xxii (1845), 397–419.59. Veillerette,op. cit.(ref. 1), 95, 103–4, 136, quoting a Lebon paper on “Disposition favorable àdonner aux machine à feu” (1791), in the archives of the Ecole Nationale Supérieure des Pontset Chaussés; Faujas-de-Saint-Fond,op. cit.(ref. 54) .
-
60. Veillerette,op. cit.(ref. 1), 134.61. “de toutes les opérations de chimie, la distillation est sans doute celle dont les usages sont les plusétendus et les plus précieux”, quoted in Williot, op. cit.(ref. 5), 15. Veillerette,op. cit.(ref. 1), 135.
-
62. Philippe Lebon,Thermolampes, ou poêles qui chauffent, éclairent avec economie, et offrent, avec plusiers produits precieux, une force motrice applicable à toute espèce de machines(Paris,1801), 1. Title of paper given in Veillerette,op. cit.(ref. 1), 138. Philippe Lebon, Patent (1799),“Moyens nouveaux d’employer les combustibles plus utilement & à la chaleur & à la lumière,& d’en receuillir leur sous-produits”, reprinted in Masse,Le gaz (Paris, 1914), Annexe I, pp.234–7. An addition was led later: Lebon “Additions” (1801), reprinted in Masse, pp. 238–47.
-
63. Lebon, Patent (1799) (ref. 62), 234
-
64. Jean-Baptiste-Charles Marchais, “Note sur la 1ère expérience du thermolampe”, in Mémoires dessociétés savantes et littéraires de la République française (Paris, 1801), 384.
-
65. “Cependant le plus grand nombre des applications du thermolampes devrait avoir pour objet dechauffer et d’éclairer, je vais les considérer particulièrement sous ce point de vue”, Lebon, Patent(1801) (ref. 62), 244.66. “c’est ainsi que plusieurs personnes se plaisent a nommer mon appareil.” Lebon, Patent (1801)(ref. 62), 240.67. Veillerette, op. cit. (ref. 1), 164–5.
-
68. “Lebons Thermolampen. Absonderung und Waschung der brennbaren Luft. Flamme in der Krystallkugel. Uebrige Zurichtungen und Wirkungen”, London und Paris, viii (1801), 206–13. The footnote in Johan Wagner, “Versuche über Lebons Thermolampen, und deren Beschreibung”, Annalen der Physik, x (1802), 491–9, quotes at some length from German journals describingboth Lebon’s apparatus and his demonstrations. See also Williot, op. cit. (ref. 5), 21.
-
69. “Thermolampes”, Journal général de la littérature de France: ou répertoire méthodique des livresnouveaux, cartes géographiques, estampes et oeuvres de musique,iv (1801), 253.
-
70. “Die grösste Unbequemlichkeit dieser Thermolampen, wenigstens jetzt noch, ist der unangenehmeGeruch, den sie verbreiten”; Wagner, op. cit.(ref. 68), 497; “Lebons Thermolampen”,op. cit.(ref. 68). “Versuch mit der Thermo-Lampe”, Magazin der Handels- und Gewerbskunde,i (1803),514–15; Williot,op. cit. (ref. 5), 22, fn 36.
-
71. Veillerette, op. cit. (ref. 1), 182. Veillerette says that it was never even opened. Zachäus Andr Winzler, Die Thermolampe in Deutschland: oder, vollständige, sowohl theoretisch- als praktische Anleitung, den ursprunglich in Frankreich erfundenen, nun aber auch in Deutschland entdektenUniversal- Leucht- Heiz- Koch- Sud- Destillir- und Sparoven zu errichten. Mit vier Kupfertafeln (Brünn, 1803), 34. For a specic sale, see p. 25. Veillerette, op. cit. (ref. 1), 191.
- 72. Veillerette, op. cit. (ref. 1), 206–9.73. An advertisement from Lebon’s wife: “Avis – Thermolampe”, Mercure de France,xlviii (1811), 240.
-
74. Henry, op. cit.(ref. 11); William Henry, “Response to Mr. Northern”,The monthly magazine, or, British register,xix (1805), 313.
- 75. “Lebons Thermolampen”,op. cit. (ref. 68); “Nützliche Entdeckungen”, Der Genius des neunzehnten Jahrhunderts, iii (1801), 261–2; “Neue Erndungen”,Oekonomische Hefte, oder Sammlungvon Nachrichten, Erfahrungen und Beobachtungen für den Stadt- und Landwirth,xvii (1801),471–4; “Thermolampe”, Der Verkündiger, oder, Wochenschrift zur Belehrung, Unterhaltungund Bekanntmachung für alle Stèande,vi (1802), 273–6; “Auszüge aus Briefen und ein Paar Zeitungsartikel”, Annalen der Physik,x (1802), 488–510; “Thermolampe und Phlogoscop”, Der Genius des neunzehnten Jahrhunderts,v (1802), 298–305; “Thermolampen oder Oefen, diemit Oekonomie erwärmen und zugleich erleuchten”,Französische Annalen für die allgemeine Naturgeschichte, Physik, Chemie, Physiologie und ihre gemeinnützigen Anwendungen,i (1802),47–59; “Notizen: Lebons thermolampe”, Allgemeines Journal der Chemie,ix (1802), 349–55,582–6; “Ausführliche Beschreibung der Thermo-Lampe, welche mehrere Zimmer oder einen Saalheizt und erleuchtet, und bey welche der Rauch nicht gemaschen wird”, Oekonomische Journaloder Nachrichten und Anzeigen aus allen Theillen der Oekonomie, Forst- und Landwirthschaft, i (1802), 466–9; Carl Gottfried Bünger, Abbildung und Beschreibung einer Thermolampe: Nebst einem zweckmässigen Apparat zur Zimmerbeleuchtung(Pirna, 1802); Johann MichaelDaisenberger, Beschreibung der Daisenberger’schen Thermolampe oder eines Sparofens, welcher alle Zimmer im ganzen Hause heitzen und beleuchten kann(1802); F. M. Scherer, “Thermolampe”, Allgemeines Journal der Chemie,ix (1802), 582–6; Wagner,op. cit.(ref. 71); Johannes BaptistaWenzler, Beschreibung einer Thermo-Lampe, oder eines Leucht- und Spar-Ofens, welcher alle Zimmer im ganzen Hause heissen, und leleuchten kann. Mit einer Kupfer-Tafel(Passau, 1802).These works also refer to many others
- 76. “Mit wenigem Holze oder einem andern Brennmaterial glaubten Viele nunmehr sich Warme undLicht zugleich verschaffen und dadurch einer Sorge überheben zu können die wie Jeder weißbei dem immer wachsenden Holzmangel nicht zu den geringsten gehört.” “Thermolampe”,op.cit.(ref. 9), 287.
- 77. One long-standing source of confusion in the historiography of the early gas industry is the existenceof three people with similar names, Zachäus (or Zachaeus) Andreas Winzler, Johannes Wenzler,who built a small thermolamp in 1802, and Friedrich Winzer, who went on to promote the rstsuccessful gas company on London and anglicized his name to Frederick Winsor.
- 78. Much of the following biographical information comes from “Winzler, Zachäus Andr.”, in Oesterreichische National-Encyklopädie, oder, Alphabetische Darlegung der wissenswürdigstenEigenthümlichkeiten des österreichischen Kaiserthumes, ed. by Johann Jakob Heinricch Czikannand Franz Gräffer (Vienna, 1835), vi, 164–5, and Helma HalvaDenk, “Bedeutende Südmährer”,Offizielle Homepage des Südmährischen Landschaftsrats (1991), www.suedmaehren.eu/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=21.
- 79. Winzler,op. cit.(ref. 71), 12–13.80. Ibid ., 20.81. Ibid ., 38.
- 82. “Winzler, Zachäus Andr.” (ref. 78), 165.
- 83. Winzler,op. cit.(ref. 71), 177–80.
- 84. “Art. IX. Gemeinnüzige Anzeigen” (ref. 9), 304–5; HalvaDenk,op. cit.(ref. 78); J. M. Zwicker, Der patriotische Forstmann: oder Lehr- und Lesebuch des Wissenswürdigsten und Nützlichsten ausden weiten Gebieten der Forst- Jagd- und Naturkunde, und deren Hülfswissenschaften (1805), 204–12, which reprints an article from thePatriotische Tageblatt entitled “Nachrichten über derersten glücklichsten Versuch mit den deutschen Thermolampe im Köngreich Böhmen”. Thereis a contemporary description of the rst experiment reprinted in Zwicker. See also “Économieforestière: Améliorations, économie du combustible”, in Annales forestières, faisant suite au Mémorial forestier, ou, Recueil complet des lois, arrêts et instructions relatifs à l’Administration forestière (Paris, 1808), 231; “Correspondance: Suite de la correspondance de M. Boudet,Pharmacien en chef”, Bulletin de pharmacie,ii (1810), 229–36, p. 286.
- 85. Hugo zu Salm-Reiferscheid, “Holzverkohlung im Grossen vermittelst der Thermolampe;geschrieben”, Annalen der Physik, xxx (1808), 402–3. “Anwendung der deutchen Thermolampeim Großsen”, Vaterländische Blätter für den österreichischen Kaiserstaat , 2 December 1812,581–3, describes the Blansko thermolamp as the rst large one. For many details see ChristianFürchtegott Hollunder, Tagebuch einter metallurgisch-technologischen reise, durch Mähren- Böhmen, einen theil von Deutschland und der Niederlande (Nürnberg, 1824), 5–25.
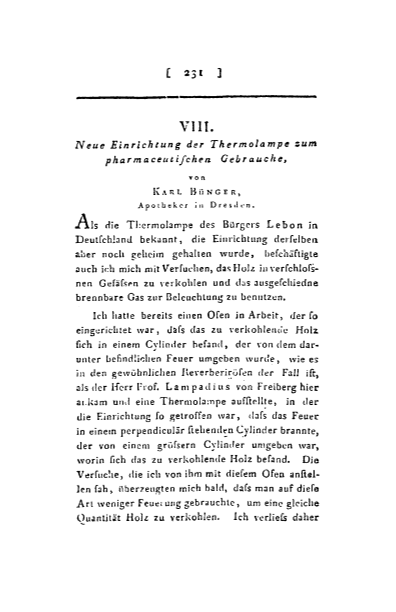
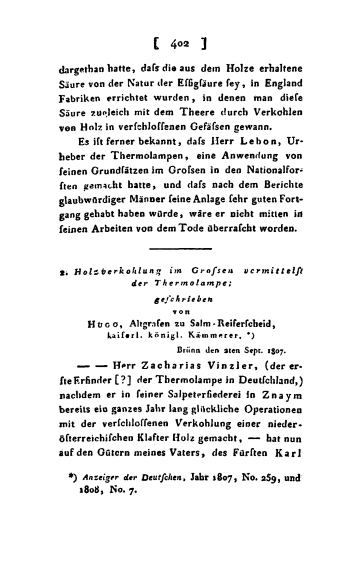
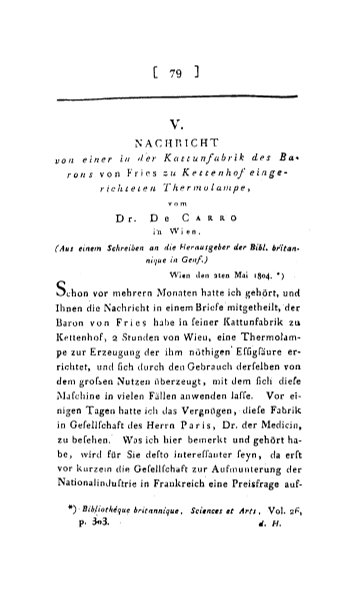
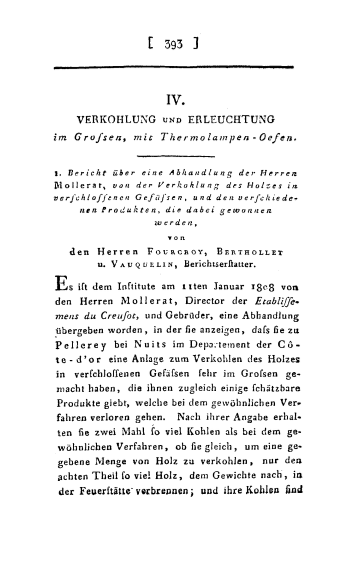
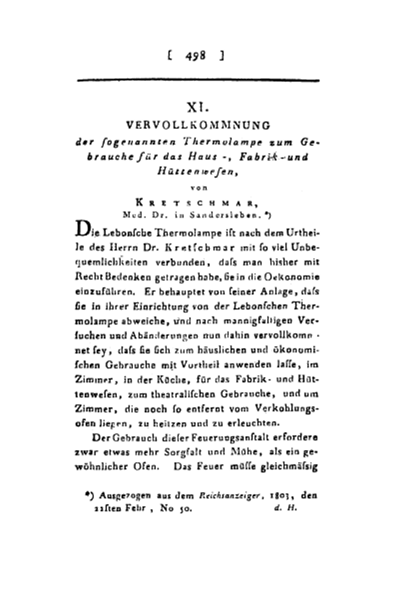
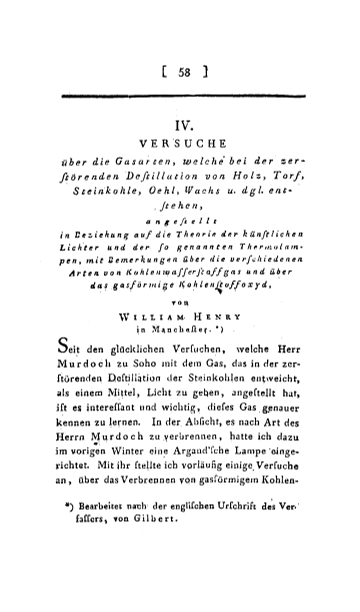
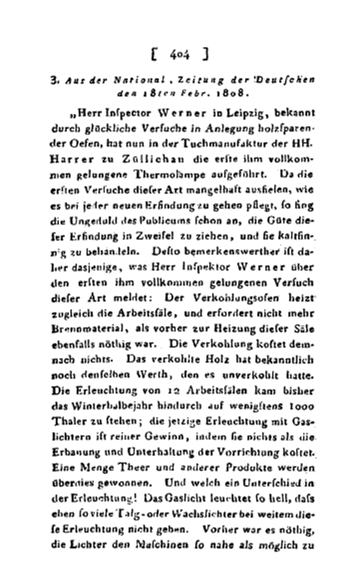
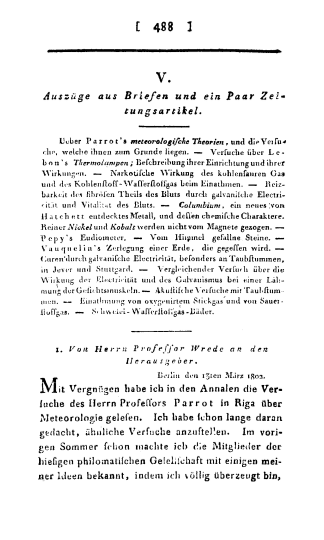
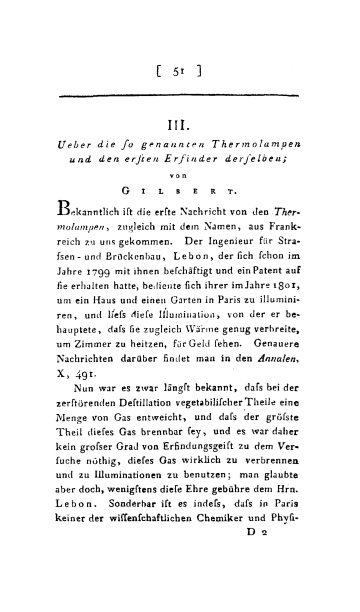
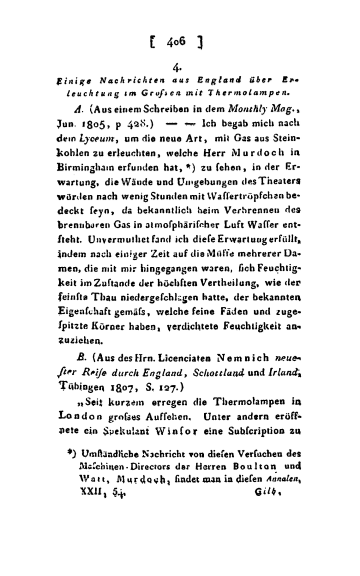
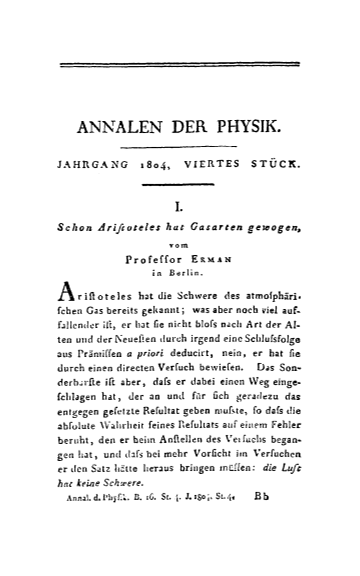
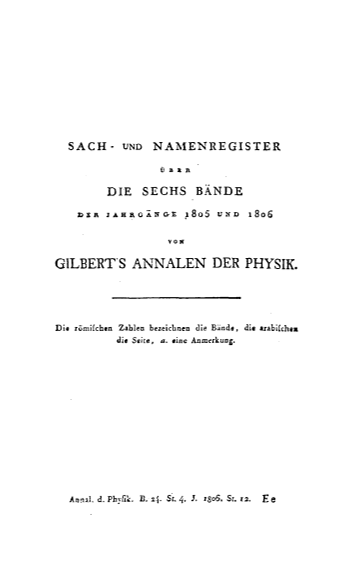
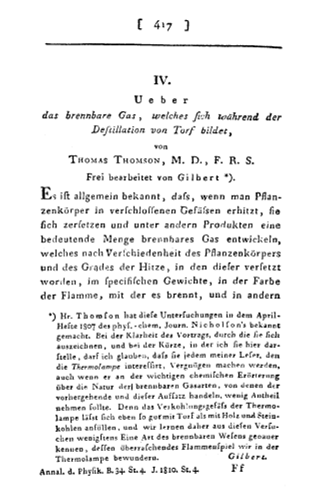
Antworten